Der Nießbrauch ist nach § 100 Bürgerlich Gesetzbuch (BGB) ein unveräußerliches, nicht vererbliches Recht, eine fremde Sache, ein fremdes Vermögen oder ein fremdes Recht zu nutzen.
Dabei ist der Nießbrauch von Sachen in § 1030 BGB und der Nießbrauch einer Erbschaft z.B. Im § 1089 BGB geregelt .
Generell verleiht das Eigentum einem Eigentümer in erster Linie drei Rechte. Hierbei handelt es sich um das Recht zur Nutzung des Eigentums, das Recht der Fruchtziehung (z. B. Mieteinnahmen) und das Recht der Verfügung (z. B. Verkauf).
Wird ein Nießbrauchsrecht vereinbart, so überträgt der Eigentümer einer Sache das Recht zur Nutzung und zur Fruchtziehung an einen Dritten und behält nur das Verfügungsrecht für sich. Dadurch wird die rechtliche Zugehörigkeit einer Sache praktisch aufgeteilt und es werden hierbei sozusagen ein Eigentümer und ein Nießbrauchers gegründet. Der Eigentümer behält hierbei nur das Recht der Verfügung und gibt die Rechte der Nutzung und der Fruchtziehung an den Nießbraucher ab.
Ein Nießbrauch kann für jeden individuellen Einzelfall angepasst werden und er ist immer sowohl dinglich als auch zeitlich begrenzbar. Grundsätzlich gibt es jedoch verschiedene Typen von Nießbrauch, die wir im Folgenden kurz vorstellen wollen:
Der Nießbrauch ist nach § 1059 BGB generell nicht an Dritte übertragbar. Hierbei ist nur eine Ausnahme bei juristischen Personen möglich. Jedoch kann die Ausübung des Nießbrauchsrechts einem anderen überlassen werden. Ferner kann der Nießbraucher die Nießbrauchsache auch nicht selbst belasten oder auch verpfänden, da er nicht das Eigentum an ihr hat. Grundsätzlich ergeben sich außerdem folgende Rechte und Pflichten für einen Nießbraucher:

Soll ein Nießbrauch vereinbart werden, so spricht man grundsätzlich von einer Bestellung des Nießbrauchs. Dabei ist diese Bestellung des Nießbrauchs je nach Art an unterschiedliche Formalitäten gebunden. Hierbei sind diese abhängig vom jeweiligen Gegenstand, der mit einem Nießbrauch belastet werden soll. Dabei gelten jeweils die folgenden Regelungen :
Bei der steuerlichen Behandlung eines Nießbrauchsrechts wird immer zwischen einem Zuwendungs- und Vorbehaltsnießbrauch unterschieden. Dabei bestellt bei einem Zuwendungsnießbrauch der Eigentümer an z. B. einem Grundstück einen Nießbrauch zugunsten des Berechtigten. Hierbei erzielt dann künftig der Nießbraucher und nicht mehr der Eigentümer die Einkünfte aus einer Vermietung und Verpachtung, wenn das Grundstück an einen Dritten vermietet oder verpachtet wird. Für den Fall dass die Bestellung des Nießbrauchs unentgeltlich erfolgte, kann der Nießbraucher allerdings in Bezug auf die Gebäudesubstanz keine Abschreibungen vornehmen. In Bezug auf den schenkungssteuerlichen Aspekt muss der kapitalisierte Wert des Nießbrauchs dann beim Empfänger versteuert werden.
Hingegen wird bei einem Vorbehaltsnießbrauch bei der Übertragung z.B. eines Grundstücks zugleich ein Nießbrauchsrecht für den bisherigen Eigentümer an dem übertragenen Grundstück bestellt. Hierbei erzielt dann z. B. bei einem Mietwohngrundstück weiterhin der Schenker die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, obwohl der Beschenkte als Eigentümer im Grundbuch steht. Dabei kann der Schenker alle von ihm getragenen Grundstücksaufwendungen steuermindernd abziehen. Solange der Nießbrauch besteht, erzielt der Beschenkte keine Einkünfte und kann mit dem Grundstück zusammenhängende Aufwendungen auch nicht steuerlich geltend machen.
Seit 1. Januar 2009 ist die Nießbrauchsbelastung in Bezug auf die Schenkungssteuer von der Bemessungsgrundlage (steuerpflichtiger Erwerb) abzuziehen und sie entfaltet damit eine steuermindernde Wirkung. Wird ein vorzeitiger unentgeltlicher Verzicht auf den Vorbehaltsnießbrauch realisiert, so erfüllt dies den Tatbestand der Schenkung nach § 7 ErbStG.
Generell kann das Recht auf Nießbrauch natürlich auch wieder aufgehoben werden. Dabei kann einerseits z. B. im Rahmen des Nießbrauchvertrags eine feste Zeitspanne für die Dauer des Nießbrauchsrechts festgelegt werden. Andererseits kann z. B. bei einem unsachgemäßen Gebrauch auch über eine Abmahnung eine Beendigung des Nießbrauchsrechts bestimmt werden. Ferner können sich natürlich auch Eigentümer und Nießbrauchnehmer jederseits einvernehmlich darüber einigen, dass ein Nießbrauchrecht enden soll. Wird das Recht auf einen Nießbrauch beendet, so ist der Nießbrauchnehmer verpflichtet, den Gegenstand des Nießbrauchs an den Eigentümer zurückzugeben nach § 1055 BGB. Für den Fall, dass sich der Nießbrauch auf ein übertragenes Recht bezogen hat, darf der Nießbraucher dieses ab diesem Zeitpunkt dann nicht mehr ausüben.
Für den Fall, dass der Nießbraucher verstirbt, wird sein Nießbrauchsrecht nach § 1061 BGB geregelt. Dabei ist geregelt, dass das Nießbrauchrecht automatisch mit dem Tod der Nießbrauchsberechtigten endet. Für den Fall, dass eine rechtsfähige Personengesellschaft Nießbraucher ist, so erlischt das Nießbrauchsrecht automatisch mit der Auflösung der Gesellschaft. Das Recht auf Nießbrauch ist also nicht vererbbar. Es handelt sich hierbei immer um ein höchstpersönliches Recht, das nicht übertragbar ist.
Das Nießbrauchrecht ist zwar nicht vererbbar, allerdings endet es auch nicht automatisch mit dem Tod des Eigentümers. In diesem Fall ist die konkrete Nießbrauchsvereinbarung entscheidend. Für den Fall, dass dem Nießbraucher ein lebenslanges Nießbrauchrecht eingeräumt wurde, so gilt dieses dann auch über den Tod des Eigentümers hinaus. Auch für den Fall, dass keine zeitliche Begrenzung vereinbart wurde, geht man von einem lebenslangen Nießbrauchrecht aus, das nicht mit dem Tod des Eigentümers endet.
Falls jedoch eine zeitliche Begrenzung des Nießbrauchs vereinbart wurde, die z. B. vorsieht, dass der Nießbrauch mit dem Tod des Eigentümers endet, ist in diesem Fall die Rechtsgültigkeit dieser Vereinbarung relevant oder eine entsprechende Eintragung im Grundbuch. Somit können also die Erben eines Eigentümers nicht automatisch davon ausgehen, dass ein Nießbrauch mit dem Eintritt des Erbfalls endet, denn das Nießbrauchrecht bleibt unabhängig vom Tod des Eigentümers bestehen, wenn nichts anderes vereinbart wurde.
Grundsätzlich kann ein Eigentümer als Erblasser natürlich auch in einem Testament oder Erbvertrag einen Nießbrauch an z. B. einer Immobilie einem Erben vermachen.
Will man ein Nießbrauchrecht ohne Zustimmung des Nießbrauchers widerrufen, muss man bereits bei Einräumung des Nießbrauchs eine Widerrufsmöglichkeit mit einer Rückauflassungsvormerkung zu Gunsten des Eigentümers verfassen. Hierbei kann sichergestellt werden, dass der Eigentümer den Nießbrauch unter bestimmten Bedingungen zurückziehen kann. Ferner ist auch der Entzug des Nießbrauchs in den Fällen möglich, in denen der Eigentümer der Sache z. B. finanziell auf die Wohnung angewiesen ist und ansonsten von Sozialleistungen leben müsste.
In der Realität kommt dem Nießbrauch häufig bei der Vermögensübertragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge eine wichtige Rolle zu. Hierbei überträgt der Eigentümer einer Sache diese bereits zu Lebzeiten das Eigentum an dieser auf einen Nachfolger, jedoch behält er sich dabei für seine eigene Lebenszeit den Nießbrauch an dieser vor. Hierbei hat er also auch bei einer Eigentumsübertragung weiterhin das recht auf den besitz der Sache und kann auch weiterhin die „Früchte“ aus dieser tragen, wie z. B. eine Immobilie zu bewohnen oder auch zu vermieten.
In diesem Fall besteht zwischen dem neuen Eigentümer und dem Nießbraucher ein gesetzliches Schuldverhältnis, das den Nießbraucher verpflichtet, die Sache zu erhalten und ordnungsgemäß zu nutzen sowie zu versichern. Ferner muss der Nießbraucher auch die üblichen öffentlichen und privatrechtlichen Lasten tragen. Außergewöhnliche Lasten sind hingegen Sache des neuen Eigentümers.
Der Nießbrauch kann rechtlich und auch steuerlich ein komplexes Thema sein, das man in vielen Fällen durchaus mit einen erfahrenen Anwalt für Erbrecht besprechen sollte. Dabei kann dieser nicht nur über die Gestaltungsmöglichkeiten des Nießbrauchs informieren und die rechtlichen Folgen, er kann auch für seine Mandanten rechtswirksame Nießbrauchverträge entwickeln.
Ferner ist ein Anwalt für Erbrecht natürlich auch bei der Erstellung einer letztwilligen Verfügung in Verbindung mit Nießbrauchsrechten der richtige Partner. Zusätzlich berät er seine Klienten insbesondere auch zur Gestaltung einer vorweggenommenen Erbfolge, bei der sich der zukünftige Erblasser Nießbrauchrechte an Vermögenswerten sichern will bis zu seinem Lebensende. Lassen Sie sich beraten von einem erfahrenen Anwalt für Erbrecht zum Thema Nießbrauch.

Das Wohnrecht ist eine eingeschränkte Form der Nutznießung. Wer das Wohnrecht in einer Liegenschaft besitzt, darf sie zwar selber bewohnen, aber nicht vermieten wie ein Nutznießer. Der Inhaber des Wohnrechts muss lediglich für die Unterhaltskosten aufkommen und den Eigenmietwert als Einkommen versteuern.
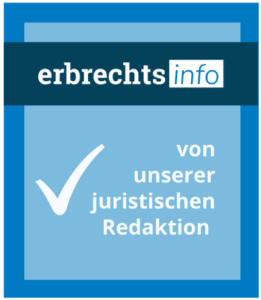
Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung