Wie ist digitaler Nachlass geregelt? Spezielle Regelungen für das digitale Erbe sind im deutschen Erbrecht nicht vorhanden. Vielmehr wirken hier mehrere Rechtsgebiete wie das postmortale Persönlichkeitsrecht, das Urheberrecht oder das Telemediengesetz zusammen. Grundsätzlich gilt deshalb für alle Erblasser, dass eine präzise Regelung des eigenen digitalen Nachlasses auch zu einer umso höheren Rechtssicherheit für die eigenen Erben nach dem eigenen Tod führt. Aus der Sicht des deutschen Erbrechts sind sowohl der digitale Nachlasses als auch digitale Güter Bestandteil der Erbmasse und Nachlassverwalter unterliegen dabei auch der Verschwiegenheitspflicht von Berufsgeheimnisträgern. Dabei geht diese Schweigepflicht, wenn dies so angeordnet wurde, auch auf die Erben für Digitales über.
Das eigene digitale Erbe kann sowohl das Datenschutzrecht, die eigenen Persönlichkeitsrechte, das Urheberrecht oder aber auch die Rechte von Dritten betreffen. Dabei können z. B. selbst erschaffene Werke wie Fotos, Musik, Filme oder Texte durchaus einen Vermögenswert darstellen. Allerdings gibt es für diese Güter im deutschen Erbrecht noch keine explizite Regelung. Deshalb greift hierbei das allgemeine Urheberrecht, das auch festlegt, dass die Rechte eines Urhebers vererbbar sind. Somit ist ein Erzeuger digitaler Werte oder ein Besitzer von Urheberrechten für Digitales also auch berechtigt, die Rechte an diesen Gütern nach seinem Tod zu vererben.
Gerade bei vorhandenen Online-Konten kann das digitale Erbe problematisch werden. Generell erben die rechtmäßigen Nachfolger eines Erblassers auch die bestehenden Online-Konten. Allerdings gilt gleichzeitig auch ein sogenanntes postmortales Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen, das seine Rechte z. B. bei Facebook auch nach dem Tod schützt. Ferner hat der Verstorbene auch online mit Dritten kommuniziert, und deshalb sind diese Daten auch durch das Datenschutzgesetz und das Fernmeldegesetz geschützt. Deshalb haben die rechtmäßigen Erben bislang zumeist keinen Zugang zu den Daten erhalten. Allerdings wurde durch ein Urteil des Bundesgerichtshof im September 2020 jedoch entscheiden, dass Erben z.B. voller Zugriff auf das Konto des US-Anbieters Facebook des verstorbenen Erblassers gewährt werden muss.
Es entzieht sich unserer Vorstellung, welch umfangreiche Menge an Daten Menschen im Internet oder als digitale Daten hinterlassen. Deshalb wollen wir im Folgenden alle Bereiche einmal auflisten und einen Überblick bieten, die als digitales Erbe bezeichnet und dementsprechend auch auf die Erben übertragen werden, nach dem eigenen Ableben. Hierzu gehören:
In Deutschland ist es noch nicht endgültig rechtlich geklärt, ob digitaler Nachlass tatsächlich vererblich ist, jedoch befürworten die bislang ergangenen unterinstanzlichen Entscheidungen die Vererblichkeit auch für digitales Erbes. Tendenziell wird den Erben ein berechtigtes Interesse daran zugesprochen, Zugang zu den Daten eines Erblassers zu erhalten, da die Erben ja auch die Pflicht zu einer ordnungsgemäßen Nachlassverwaltung und -abwicklung trifft gemäß § 1967 BGB.
Ferner müssen auch die potentiellen Erben innerhalb einer Frist von 6 Wochen gemäß § 1944 BGB über eine Annahme bzw. Ausschlagung der Erbschaft entscheiden. Hierfür müssen sie zumeist auch den E-Mail Verkehr des Erblassers prüfen und sich einen Überblick verschaffen, um evtl. noch offene Rechnungen ausfindig zu machen. Generell gehören die von einem digitalen Nachlass begründeten Rechtspositionen zur Erbmasse dazu und gehen deshalb auch auf die rechtmäßigen Erben über nach § 1922 Abs. 1 BGB. Daraus folgt dann auch, dass die Erben eines Accountinhabers in den Nutzungsvertrag mit einem Provider eintreten und ihnen deshalb auch grundsätzlich derselbe Anspruch auf Nutzung der Accounts zusteht wie zuvor dem Erblasser auch. Dies gilt dann auch für Auskunftsansprüche gegen den Provider bezüglich der Zugangs- und Vertragsdaten. Hierbei ist dies bei sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook noch nicht abschließend geregelt.
Digitaler Nachlass kann heute genauso wichtig sein wie andere materielle Vermögenswerte, die man seinen Erben hinterlässt. Deshalb sollte man also ein Interesse daran haben, die eigene digitale Hinterlassenschaft auch so zu regeln, dass die eigenen Erbe auch im Sinne des Erblassers handeln und dazu auch in die Lage versetzt werden, indem sie einen Überblick haben. Hierzu kann man in einer Vollmacht oder auch in einem Testament Anweisungen erteilen, wie mit dem eigenen digitalen Nachlass nach dem eigenen Ableben zu verfahren ist. Auch für den Fall, dass man als Erblasser keine Passwörter hinterlässt, muss ein Provider nach einer Entscheidung des BGH den Erben einen Zugriff auf ein Online-Nutzerkonto gewähren.
In der analogen Lebenswelt kann man Geschäftsbeziehungen meist einfach nachvollziehen und ein Erbe ist berechtigt, auf die Unterlagen eines Erblassers zuzugreifen. Hingegen sieht es bei allen Aktivitäten im Internet anders aus. Hierbei kann ein Erbe ohne Passwörter und weitere Zugangsdaten keinen Überblick über den digitalen Nachlass oder ein Konto erhalten und somit auch nicht die Pflichten erfüllen, die sich den Rechtsbeziehungen über das Internet ergeben. Deshalb wird er in diesem Fall eventuell sowohl Verbindlichkeiten aus Verträgen mit Internetanbietern nicht erfüllen können oder auch Geschäftsbeziehungen nicht auflösen können.
Für den Fall, dass ein Erblasser ein Girokonto nur online bei einer Online-Bank, muss ein Erbe zunächst einmal Kenntnis davon haben um einen Einblick nehmen zu können und darauf zugreifen zu können. Hierfür benötigt ein Erbe ferner auch Zugangsdaten und Passwörter. Wenn ein Erblasser hierzu keine Unterlagen hinterlassen hat, wird ein Erbe ggf. keine Kenntnis über die Existenz des Kontos erlangen. Hierbei kann dann auch im ungünstigsten Fall ein Guthaben auf diesem Konto nach einer bestimmten zeit ohne einen Zugriff darauf dann an die Bank fallen.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, über die eigenen Online- Aktivitäten eine Übersicht zu erstellen. Hierbei kann man dann alle aktiven Accounts auflisten und die entsprechenden Informationen für den Zugang beifügen. Dabei bezeichnet man dann alle Institutionen, bei denen man ein aktives Nutzerkonto unterhält und gibt die entsprechende Webseite hierzu an. Ferner fügt man dann die entsprechenden Benutzernamen und Passwörter sowie ggf. weitere Zugangsdaten hinzu.
Hierdurch kann ein späterer Erbe dann Zugriff auf die Nutzerkonten nehmen und er muss auch nicht befürchten, dass ihm dann ein Zugriff durch den Anbieter verwehrt wird. Deshalb kann er dann auch im Sinne des Erblassers Handlungen vornehmen und z. B. Nutzungsverträge kündigen und Nutzerkonten löschen sowie auch ggf. ein Online-Konto weiterführen. Ähnlich sollte man auch mit digitalen Vermögenswerten verfahren, für die man Urheberrechte oder sonstige Rechte besitzt. Für den Fall, dass man eine Einsichtnahme Dritter in die eigenen Unterlagen vermeiden will, kann man diese Übersichten auch auf einem USB-Stick speichern und an einem sicheren Platz verwahren, der im Erbfall zugänglich wird, wie z. B. In einem Bankschließfach oder einem Tresor.
Um nach dem eigenen Ableben zu gewährleisten, dass auch mit der eigenen digitalen Hinterlassenschaft entsprechend den eigenen Wünschen verfahren wird, hat ein Erblasser mehrere Möglichkeiten, hierzu Regelungen zu treffen. Dabei kann zunächst eine Vertrauensperson bestimmen, der man die Abwicklung der digitalen Hinterlassenschaft anvertraut. Ferner lassen sich auch in einem Testament Verfügungen zu einer weiteren Regelung der digitalen Hinterlassenschaft bestimmen. Außerdem kann man auch einen externen, kommerziellen Anbieter beauftragen den eigenen digitalen Nachlass zu verwalten.
Wenn man eine Person des eigenen Vertrauens mit der Aufgabe betraut, den eigenen digitalen Nachlass nach dem Ableben zu regeln, muss diese Person nicht unbedingt auch ein Erbe sein, sondern sie kann unabhängig davon zum digitalen Nachlassverwalter bestimmt werden. Hierfür kann man in einer entsprechenden Vollmacht regeln, wie diese Vertrauensperson mit dem digitalen Nachlass umgehen soll. Dabei sollte man dann genaue Angaben machen, welche Nutzerkonten und ggf. welcher E-Mail Verkehr gelöscht werden soll. Ferner kann man auch für die Konten in sozialen Netzwerken festlegen, ob diese einfach gelöscht werden sollen, oder ob ggf. eine sogenannte Gedenkseite eingerichtet werden soll.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, eine derartige Vollmacht handschriftlich zu formulieren und mit Datum und einer vollständigen Unterschrift zu versehen. Außerdem sollte man in der Vollmacht auch ausdrücklich erklären, dass diese über den eigenen Tod hinaus Gültigkeit haben soll.

Neben der beschriebenen Vollmacht kann man auch in einem Testament Verfügungen treffen, wie mit dem eigenen digitalen Nachlass zu verfahren ist. Hierbei richtet man sich mit einer derartigen Verfügung an die Erben und man kann auch auf diese Weise genaue Angaben zu den einzelnen Verfahrensweisen beim digitalen Erbe machen. Dabei lässt sich z. B.auch bestimmen, dass der eigene Computer, Handy oder Tablet nach dem eigenen Ableben vernichtet und entsorgt werden soll um zu gewährleisten, dass ein weiterer Zugriff auf die eigenen Daten ausgeschlossen ist. Ferner erhält ein Erbe in sozialen Netzwerken zumeist keinen Zugriff auf das Profil des verstorbenen Inhabers. Für den Fall, dass der Erbe eine Sterbeurkunde des Inhabers und zum Nachweis seiner eigenen Identität als Erbe ein offizielles Ausweisdokument vorlegen kann, wird das Konto zumeist inaktiv geschaltet („Gedenkmodus“) oder gelöscht.
Ferner kann man auch einen kommerziellen Anbieter beauftragen, den eigenen digitalen Nachlass nach dem Ableben zu verwalten. Hierbei muss man jedoch gewährleisten, dass der entsprechende Anbieter vom eigenen Ableben auch erfährt. Allerdings besteht bei dieser Vorgehensweise natürlich auch immer die Gefahr, dass der jeweilige Anbieter nicht so vertrauensvoll und zuverlässig arbeitet, wie dies vereinbart war. Damit verbleibt auch ein Restrisiko, wie mit den eigenen Daten nach dem Ableben tatsächlich verfahren wird.
Wenn man sich Gedanken über den eigenen digitalen Nachlass macht, kann es oft hilfreich sein, sich hierbei mit einem erfahrenen Anwalt für Erbrecht zu beraten. Dabei kann ein Anwalt dabei helfen, die im individuellen Fall passenden Entscheidungen zur Vorgehensweise zu finden und er kann seinen Mandanten auch aktiv unterstützen, um z. B. eine Vollmacht anzufertigen oder eine entsprechende Verfügung für ein Testament zu formulieren.
Ferner kann ein Anwalt auch selbst beauftragt werden, den eigenen digitalen Nachlass nach dem eigenen Ableben zu verwalten oder dafür sorgen, dass entsprechend der eigenen Wünsche nach dem eigenen Ableben auch entsprechend verfahren wird. Außerdem kann ein Anwalt für Erbrecht auch dabei unterstützen, ggf. einen externen kommerziellen Anbieter zu finden, der nach dem eigenen Ableben diese Aufgabe übernehmen kann. Lassen sie sich beraten zum digitalen Nachlass von einem erfahrenen und spezialisierten Anwalt für Erbrecht.

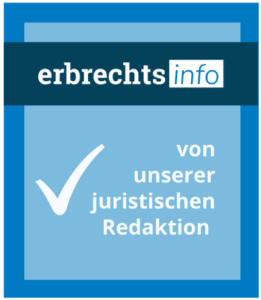
Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung