Hat ein Erblasser einen pflichtteilsberechtigten Verwandten durch ein Testament oder einen Erbvertrag enterbt, so steht diesem nach dem Erbrecht ein Anspruch auf einen Pflichtteil am Erbe zu.
Dabei gilt dann, trotzdem der Erblasser in seinem letzten Willen angeordnet hat, dass der Enterbte nichts erhalten soll, hat der Pflichtteilsberechtigter trotzdem einen Anspruch auf eine vom Gesetz garantierte Mindestbeteiligung am Erbe und zwar in Höhe des Wertes der Hälfte seines gesetzlichen Erbteils.
Dies gilt auch im Falle von Schenkungen an Miterben zu Lebzeiten des Erblassers.
Deshalb kann ein Erblasser diesen Anspruch auf den Pflichtteil auch nicht dadurch umgehen, indem er sein Vermögen noch zu seinen Lebzeiten verschenkt. In diesem Fall, wenn z. B. das Vermögen an andere Erben schon zu Lebzeiten verschenkt wird, steht dem Pflichtteilsberechtigten ein so genannter Pflichtteilsergänzungsanspruch nach§ 2325 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu. Hierbei wird dann die Schenkung nach bestimmten Regeln wertmäßig zum Nachlass hinzugerechnet und dementsprechend erhöht sich auch der Wert des Nachlasses, von dem der Pflichtteil berechnet wird.
Für den Fall, dass die Schenkungen an Dritte und nicht an erbberechtigte Personen gegangen sind, sieht § 2329 BGB vor, dass sich ein Pflichtteilsberechtigter dann auch an Dritte wenden kann, die durch den Erblasser beschenkt wurden. Oberste Maxime der gesetzlichen Regelungen ist, dass der Pflichtteil jedenfalls geschützt werden soll. Es ist dem Erblasser verwehrt, den Pflichtteil durch lebzeitige Transaktionen auszuhöhlen oder sogar ganz zu entwerten.
Der grundsätzliche Schutz des Pflichtteils greift selbst dann, wenn ein Erblasser gar kein Testament hinterlassen hat und deshalb auch keinen seiner pflichtteilsberechtigten Erben enterbt hat. Für den Fall, dass der Erblasser unter diesen Umständen jedoch sein Vermögen zu Lebzeiten durch Schenkungen bereits verteilt hat, kann ein Pflichtteilsberechtigter ebenfalls nach dem Ableben des Erblassers einen Pflichtteilsergänzungsanspruch geltend gegen die Erben machen, wenn er bei den Schenkungen leer ausgegangen ist.
Ein Vater hatte das Eigenheim, das sein einziges Vermögen war, zu Lebzeiten durch eine Schenkung auf den Sohn übertragen. Er hatte ferner kein Testament errichtet. Nach dem Ableben des Vaters stellte die Tochter fest, dass praktisch kein Nachlass vorhanden ist. Deshalb machte die Tochter wegen der lebzeitigen Schenkung einen Pflichtteilsergänzungsanspruch nach § 2329 BGB gegen ihren Bruder geltend. Letztendlich hat der Bundesgerichtshof dem Anspruch stattgegeben, da es festgestellt hat, dass das Pflichtteilsergänzungsrecht den nächsten Angehörigen eines Erblassers Rechtsschutz dagegen gewähren soll, wenn ein Erblasser sie zu seinen Lebzeiten durch eine Schenkung um ihren Pflichtteil bringt.
Ist ein Pflichtteilsberechtigter enterbt worden und das Vermögen des Erblassers zu seinen Lebzeiten weitgehend verschenkt worden, wird die Höhe seines Pflichtteilsergänzungsanspruchs abhängig vom Wert der Schenkungen sein. Hierbei spielen aber nur diejenigen Schenkungen der letzten zehn Jahre eine Rolle, gemäß der Zehn-Jahres-Frist. Deshalb sind auch Schenkungen, die mehr als zehn Jahre zurückliegen, nicht mehr bei der Ermittlung des Ergänzungsanspruchs abgedeckt. Außerdem werden auch sogenannte Anstandsschenkungen wie z. B. Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke nicht hinzugezählt und sie begründen deshalb auch keinen Pflichtteilsergänzungsanspruch nach § 2330 BGB.
Andere Schenkungen werden nach einem Abschmelzungsmodell berücksichtigt. Hierbei wird eine Schenkung, je länger sie bereits her ist, mit einem geringer werdenden Anteil angerechnet.
Grundsätzlich wird bei der Ermittlung des Werts der Schenkung auch zwischen verbrauchbaren und nicht verbrauchbaren Sachwerten unterschieden:
Hierzu zählt man z. B. Geld und Wertpapiere. Diese werden mit ihrem Wert zum Zeitpunkt der Schenkung veranschlagt. Deshalb ist es bei der Berechnung nicht relevant, ob die Schenkung zwischenzeitlich verbraucht wurde oder auch verloren gegangen ist.
Hierzu zählen z. B. Immobilien, Kunst etc. Bei diesen Werten ist das Niederstwertprinzip entscheidend. Hierbei wird dann der Wert zum Zeitpunkt der Schenkung in Relation zum Wert zum Zeitpunkt des Todes gesetzt. Dabei wird dann der sich daraus ergebende niedrigste Wert bei der Ermittlung des Wertes der Schenkung berücksichtigt.
Gemäß dem Abschmelzungsmodell werden alle Schenkungen der letzten 10 Jahre vor dem Erbfall berücksichtigt, und zwar mit jedem Jahr, um das die Schenkung weiter zurückliegt, um 10 % weniger. Daraus ergibt sich folgendes Abschmelzungsmodell:
| Schenkung erfolgte | Berücksichtigung des Schenkungswertes beim Pflichtteilsergänzungsanspruch |
|---|---|
| im 1. Jahr vor dem Erbfall | 100% |
| im 2. Jahr vor dem Erbfall | 90% |
| im 3. Jahr vor dem Erbfall | 80% |
| im 4. Jahr vor dem Erbfall | 70% |
| im 5. Jahr vor dem Erbfall | 60% |
| im 6. Jahr vor dem Erbfall | 50% |
| im 7. Jahr vor dem Erbfall | 40% |
| im 8. Jahr vor dem Erbfall | 30% |
| im 9. Jahr vor dem Erbfall | 20% |
| im 10. Jahr vor dem Erbfall | 10% |
| im 11. Jahr vor dem Erbfall oder früher | 0% |

Beispiel für die Anrechnung
Der Erblasser hat zwei Kinder und keinen Ehegatten mehr. In einem Testament hat er seinen Sohn als Alleinerben eingesetzt. Seine Tochter als Pflichtteilsberechtigte, erhält somit nur den Pflichtteil, der der Hälfte des gesetzlichen Erbteils entspricht. In diesem Fall wäre der gesetzliche Erbteil bei zwei Kindern also die Hälfte des Nachlasses, der Pflichtteil entsprechend ein Viertel des Nachlasses. Der Nachlass beträgt zum Todeszeitpunkt 50.000 €. Allerdings hat der Erblasser vor seinem Tod eine Immobilie im Wert von 120.000 € durch eine Schenkung übertragen. Hieraus ergeben sich, in Abhängigkeit vom Schenkungszeitpunkt, folgende Ansprüche der enterbten Tochter:
| Nachlasswert ohne Schenkung | Gesetzlicher Pflichtteilsanspruch (1/4) der Tochter | Wert der Schenkung | Zeitpunkt der Schenkung | Höhe des Ergänzungs-anspruchs | Neuer Nachlasswert | Neuer Pflichtteils- anspruch (1/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 Euro | 12.500 Euro | 120.000 Euro | 2 Jahre vor dem Tod des Erblassers | 90 % = 108.000 Euro | 158.000 Euro | 39.500 Euro |
| 50.000 Euro | 12.500 Euro | 120.000 Euro | 8,5 Jahre vor dem Tod des Erblassers | 20 % = 24.000 Euro | 74.000 Euro | 18.500 Euro |
Bei Schenkungen unter Ehegatten gilt eine Sonderregelung zugunsten von Pflichtteilsberechtigten. Wenn eine Ehe durch den Tod eines Ehegatten aufgelöst wird, sind alle während der Ehe vom Erblasser gemachten Schenkungen an den überlebenden Ehegatten ergänzungspflichtig. Dabei gilt dies auch, wenn diese schon jahrzehntelang zurück liegen. Dabei bleiben die Schenkungen zwar wirksam und werden auch nicht rückgängig gemacht, jedoch gehen sie immer in die Berechnung eines Pflichtteils oder Pflichtteilsergänzungsanspruches ein.
Für den Fall, dass ein Pflichtteilsberechtigter im Erbfall leer ausgegangen ist, jedoch zu Lebzeiten des Erblassers bereits Schenkungen von diesem erhalten hat, werden diese gemäß § 2315 BGB nur dann auf den Pflichtteil angerechnet, wenn der Erblasser dies ausdrücklich angeordnet hat. Hierbei gilt auch keine zeitliche Begrenzung , wie bei der Anrechnung von anderen Schenkungen (Zehn-Jahres-Frist). Dabei muss diese Anrechnungsanordnung bereits zum Zeitpunkt der Schenkung dem Pflichtteilsberechtigten mitgeteilt werden und er kann auch zu diesem Zeitpunkt dann entscheiden, ob er die Schenkung unter diesen Bedingungen annimmt oder ablehnt.
Anders geregelt als beim als Pflichtteilsanspruch ist die Anrechnung von Schenkungen zu Lebzeiten für den Anspruch auf Pflichtteilsergänzung. Hierbei sind diese Schenkungen auf einen Pflichtteilsergänzungsanspruch immer anzurechnen, auch wenn der Erblasser dies nicht angeordnet hat gemäß § 2327 BGB. Auch hierbei gibt es keine zeitliche Begrenzung (10 -Jahres- Frist) für die anrechnungspflichtigen Zuwendungen. Hiervon ausgenommen sind jedoch sogenannte Pflicht- oder Anstandsschenkungen im Sinne des §2330 BGB. Hierzu gehören z. B. Schenkungen zu einem Geburtstag oder einer Hochzeit. Diese können zwar auch einen hohen Wert haben, müssen jedoch immer im Verhältnis zum Anlass und den Vermögensverhältnissen des Erblassers stehen und deshalb auch sittlich geboten sein, um eine Pflichtteilsergänzung auszuschließen.
Auch gemischte Schenkungen, also Zuwendungen des Erblassers, bei denen er zumindest teilweise vom Beschenkten auch Gegenleistungen erhält, können in Höhe des unentgeltlichen Anteils der Pflichtteilsergänzung unterworfen sein.
Pflichtteilsansprüche verjähren 3 Jahre nach Kenntnis über den Todesfall und den Anspruch. Hingegen verjähren Pflichtteilsergänzungsansprüche gegen die Erben innerhalb von drei Jahren nach Kenntnis über die Schenkung gemäß §§ 195, 199 Abs. 1 BGB. Hierbei beginnt die Frist in beiden Fällen immer mit dem Ende desjenigen Jahres zu laufen, in dem man Kenntnis erlangt hat. Für den Fall, dass ein Pflichtteilsberechtigter z. B. am 10.März 2018 von einem Erbfall und entsprechenden Schenkungen erfahren hat, beginnt diese 3-Jahres-Frist erst am 31.12.2018. Eine Verjährung tritt demnach dann zum 31.12.2021 ein.
Für den Fall jedoch, dass ein Pflichtteilsberechtigter erst nach einigen Jahren von den Schenkungen oder Zuwendungen des Erblassers erfährt, beginnt auch erst dann die Frist für einen Pflichtteilsergänzungsanspruch zu laufen. Hierbei beträgt dann die maximale Verjährungsfrist 30 Jahre und danach können dann keine erbrechtlichen Ansprüche mehr geltend gemacht werden. Deshalb kann es in manchen Fällen auch vorkommen, dass z. B. ein Pflichtteilsanspruch bereits verjährt ist, ein entsprechender Pflichtteilsergänzungsanspruch jedoch noch nicht, da der Berechtigte erst sehr viel später von einer Schenkung oder Zuwendungen erfahren hat.
Bei Schenkungen von Immobilien behält sich der schenkende Erblasser häufig ein Nießbrauchsrecht vor, um die Immobilie weiterhin selbst nutzen oder vermieten zu können. Hierbei wird zwar der Beschenkte formal in das Grundbuch als Eigentümer eingetragen, allerdings bleibt der schenkende Erblasser dabei der wirtschaftliche Eigentümer.
Hierbei hat diese Absicherung des Schenkers jedoch in Bezug auf das Pflichtteilsrecht den Nachteil dass es bei einer derartigen Schenkung an einem sogenannten „Genussverzicht“ fehlt . Deshalb wurde hierbei durch eine Entscheidung des BGH entschieden, dass die 10-Jahres-Frist des § 2325 Abs. 3 BGB erst dann beginnt, wenn der schenkende Erblasser auf den Nießbrauch verzichtet zu einem späteren Zeitpunkt. Deshalb verhindert eine Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt den Fristbeginn und kann dadurch Pflichtteilsergänzungsansprüche auslösen. Allerdings kann bei einer Berechnung des Wertes der Schenkung der vorbehaltene Nießbrauch wertmindernd berücksichtigt werden.
In vielen Fällen bei Schenkungen von Immobilien behält sich der schenkende Erblasser zwar kein Nießbrauchsrecht vor, jedoch ein Wohnrecht , weil er keine Absichten verfolgt, die Immobilie weiter zu vermieten. Hierbei kann sich dieses Wohnrecht am Schenkungsobjekt auch nur auf ein anteiliges Wohnrecht beziehen und eben nicht auf die ganze Immobilie. Dabei wird in der Rechtsprechung überwiegend entscheiden, dass der Beginn der Fristen für Zuwendungen und Schenkungen nur dann ausgesetzt ist, wenn die Nutzfläche, die dem Wohnungsrecht unterliegt, verglichen mit der Restwohnfläche, überwiegt.
Häufig wird bei Schenkungsverträgen von Immobilien wird auch anstatt eines Nießbrauchsrecht die Zahlung einer Leibrente durch den Beschenkten vereinbart. Hierbei wird in der Rechtsprechung angenommen, dass eine derartige Vereinbarung für den Beginn der Frist der Anrechnung von Schenkungen nach § 2325 Abs. 3 BGB nicht erheblich ist und diese trotzdem nach dem Abschmelzungsmodell für Pflichtteile und Pflichtteilsergänzungssprüche berücksichtigt wird. Deshalb empfiehlt es sich im Zweifelsfall für einen Schenker, statt einem Nießbrauchsrecht eine Leibrentenzahlung in einem Schenkungsvertrag zu vereinbaren.
Ist man als Pflichtteilsberechtigter enterbt worden und hat in Erfahrung gebracht, dass der Erblasser umfangreiche Schenkungen zu Lebzeiten vorgenommen hat, braucht er kompetenten Rat, welche Ansprüche er in einem solchen Fall geltend machen kann. Hierbei ist ein erfahrener Anwalt für Erbrecht ein idealer Partner, der seinem Mandanten bei den komplexen erbrechtlichen Regelungen tatkräftig unterstützen kann.
Hierbei kann er ihn z. B. unterstützen, ein vollständiges Nachlassverzeichnis von den Erben einzufordern und dafür sorgen, dass auch die relevanten lebzeitigen Schenkungen berücksichtigt werden. Ferner kann er seinen Mandanten auch darüber informieren, inwiefern auch Schenkungen oder Zuwendungen, die er selbst bereits zu Lebzeiten des Erblassers erhalten hat, auf seine Ansprüche angerechnet werden. Ferner kann er natürlich auch zukünftige Erblasser beraten, die durch Schenkungen zu Lebzeiten bereits die Aufteilung ihres Nachlasses planen wollen und diese zu möglichen Pflichtteilsansprüchen und Pflichtteilsergänzungsansprüchen nach dem Erbrecht beraten.

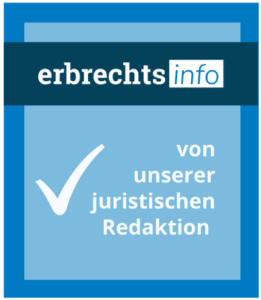
Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung