Hat ein Erblasser ein Testament hierlassen, geht es darum, den darin dokumentierten „letzten Willen“ dieser Person zu verwirklichen. Um dies gewährleisten zu können, hat gemäß §348 Abs. 1 FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) das Nachlassgericht die Pflicht, das Testament im Zuge der Testamentseröffnung zu öffnen und den darin enthaltenen letzten Willen des Erblassers allen Erbberechtigten sowie gegebenenfalls begünstigten Vermächtnisnehmern mitzuteilen.
Um eine Umsetzung eines Testaments nicht vom Belieben der Angehörigen abhängig zu machen, wird der Inhalt eines Testamentes amtlich festgestellt.
Hierbei muss jedoch unterschieden werden, ob ein Testament bereits in amtlicher Verwahrung war oder ob es eben nicht beim zuständigen Nachlassgericht hinterlegt wurde. Die beiden unterschiedlichen Fälle sollen im Folgenden dargestellt werden.
Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung, ein Testament bei einem Nachlassgericht zu hinterlegen und es kann genauso gut zuhause oder an einem anderen Ort verwahrt werden. Für den Fall jedoch, dass die letztwillige Verfügung amtlich verwahrt wurde, hat der Erblasser dieses zu seinen Lebzeiten beim örtlichen Amtsgericht für eine Aufbewahrung hinterlegt. Falls der Erblasser den Inhalt seines letzten Willens bei einem Notar hat beurkunden lassen, so ist dieser ebenfalls verpflichtet, das Testament beim Amtsgericht als zuständigen Nachlassgericht abzugeben.
Dabei gilt im Falle einer amtlichen Verwahrung, dass das Nachlassgericht nach § 348 FamFG eine in seiner Verwahrung befindliche letztwillige Verfügung immer dann eröffnen muss, wenn es vom Ableben des Erblassers Kenntnis erlangt. Hierbei muss von einer Testamentseröffnung dann auch eine Niederschrift erstellt werden.
Für den Fall, dass ein Angehöriger oder auch eine andere Person nach dem Ableben eines Erblasser in den Unterlagen ein Testament auffindet, ist die entsprechende Person verpflichtet, diese letztwillige Verfügung sofort beim Nachlassgericht abzuliefern. Wird ein Testament wegen seinem Inhalt vernichtet oder auch unterschlagen, so ist dadurch ein Straftatbestand erfüllt, der nach § 274 StGB als Urkundenunterdrückung bezeichnet wird.
Hingegen spricht man von Urkundenfälschung nach § 267 StGB und Betrug gemäß § 263 StGB, wenn ein Testament verfälscht wurde. Dabei riskiert die entsprechende Person dann auch, dass sie für erbunwürdig erklärt wird und ggf. ein gesetzlich vorgesehenes Erbrecht verliert und sie kann auch den rechtmäßigen Erben gegenüber schadenersatzpflichtig sein, wenn sie eine Umsetzung des Testamentes verhindert und den Erben dadurch Vermögen aus dem Nachlass entgeht.
Wenn ein Nachlassgericht von einer Existenz eines Testamentes erfährt, kann es den Besitzer durch einen amtlichen Beschluss auffordern, die Unterlagen abzuliefern. Ferner kann das Nachlassgericht auch eine eidesstattliche Versicherung von Personen über den Verbleib eines Testamentes verlangen. Für den Fall, dass die Herausgabe verweigert wird, kann das Gericht die Herausgabe mit Zwang durchsetzen und eine Ordnungsstrafe verhängen.
Generell liegt es also nicht in der Entscheidung von Angehörigen, ein Testament eines Erblassers selbst zu interpretieren, es im eigenen Besitz zu behalten oder es abzuliefern beim Nachlassgericht. Deshalb darf auch niemand die Ablieferung eines Testamentes verweigern, weil er es für unwirksam hält nach dem Erbrecht. Hierbei steht es eben nur dem zuständigen Nachlassgericht zu, festzustellen, ob ein Testament wirksam errichtet wurde oder auch nicht. Auch für den Fall, dass es nur einen Alleinerben gibt, muss dieser ein vorhandenes Testament beim Nachlassgericht . Nur dadurch kann seine Stellung als Erbe amtlich feststellen lassen und vermeiden, dass seine Erbenstellung ggf. später noch von anderen eventuellen Erben angefochten wird. Außerdem wäre auch eine Anordnung des Erblassers selbst, dass sein Testament nach seinem Ableben nicht eröffnet werden soll, nach § 2263 BGB nichtig.
Die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts liegt immer in dem Bezirk, in dem ein Erblasser zuletzt seinen Wohnsitz hatte und dort einwohneramtlich auch gemeldet war. Für den Fall, dass ein Erblasser zuletzt in einem Pflegeheim wohnte, ist er dort zumeist auch als Einwohner registriert worden. Ein Nachlassgericht ist immer eine Abteilung eines Amtsgerichtes und dort nimmt regelmäßig ein Rechtspfleger die Aufgaben rund um die Testamentseröffnung wahr.
Für den Fall, dass ein Erblasser keinen Wohnsitz im Inland hatte, ist für seinen Nachlass immer das Nachlassgericht des letzten Aufenthaltsortes zuständig. Wenn er jedoch zum Zeitpunkt seines Ablebens weder einen Wohnsitz noch einen Aufenthalt in Deutschland hatte, er jedoch deutscher Staatsangehöriger war, ist das Amtsgericht Berlin-Schöneberg als Nachlassgericht zuständig. Falls ein Erblasser jedoch ein ausländischer Staatsangehöriger war, der weder Wohnsitz noch Aufenthalt in Deutschland hatte, so kann jedes Amtsgericht, in dessen Bezirk sich Nachlassgegenstände befinden, auch für den gesamten Nachlass das zuständige Nachlassgericht sein nach dem Erbrecht.
Normalerweise wird das Nachlassgericht über einen Todesfall vom Standesamt unterrichtet, bei dem die Angehörigen den Sterbefall gemeldet haben. Wenn dabei vom Erblasser zu Lebzeiten ein Testament in die amtliche Verwahrung gegeben wurde, wurde dieses von Amts wegen immer beim Deutschen Testamentsregister registriert. Dabei wird das Standesamt dann auch das Deutsche Testamentsregister vom Todesfall in Kenntnis setzen und dieses wird dann feststellen, ob eine letztwillige Verfügung des Erblassers registriert wurde und wo diese verwahrt wird. Da das Standesamt auch das zuständige Nachlassgericht informiert, ist bestmöglich gewährleistet, dass Testamente zuverlässig aufgefunden werden und eine Testamentseröffnung stattfinden kann.
Für den Fall, dass ein Erblasser zwischenzeitlich umgezogen war, so ist trotzdem das verwahrende Amtsgericht für die Testamentseröffnung zuständig und wird dann das Testament auch eröffnen. Allerdings wird es auch das originale Testament inkl. Einer beglaubigten Abschrift des Testaments Eröffnungsprotokolls an das Amtsgericht am Wohnort des Erblassers schicken.
Gesetzlich geregelt ist im Falle einer Testamentseröffnung, dass zunächst der Archivar am Nachlassgericht ein Testament aus seiner amtlichen Verwahrung an den zuständigen Rechtspfleger beim Nachlassgericht zu einer weiteren Bearbeitung übergibt. Dieser empfängt auch die Testamente, die bei den Nachlassgerichten abgeliefert werden in einem Erbfall. Wenn die Dokumente dem Gericht vorliegen, beginnt dieses im Anschluss mit der Testamentseröffnung. Grundsätzlich kann sich diese auf folgende letztwillige Verfügungen beziehen:
Generell wird ein Rechtspfleger zur Testamentseröffnung die gesetzlichen Erben sowie weitere Beteiligte zu einem Termin laden oder informieren. Dabei kommen als Beteiligte in Frage:
Grundsätzlich lädt ein Nachlassgericht zu einer Testamentseröffnung nur Personen, die erreichbar sind und von deren Existenz das Gericht Kenntnis hat. Dabei ist der zuständige Rechtspfleger jedoch nicht verpflichtet, amtliche Ermittlungen anzustellen, welche weiteren Personen noch als gesetzliche Erben in Frage kommen oder welche anderen Personen noch Rechte an einem Nachlass haben könnten. Viele Nachlassgerichte verzichten auch auf einen Testaments Eröffnungstermin und senden den Beteiligten nach einer internen Testamentseröffnung eine Abschrift des Testaments und des Protokolls der Testamentseröffnung. Daraufhin bleibt es dann jedem Erben überlassen, einen Erbschein zu beantragen oder anderweitig Rechte am Nachlass des Erblassers geltend zu machen.
Nach einer Testamentseröffnung kann jedermann, der ein rechtliches Interesse an einer Einsicht ins Testament glaubhaft machen kann, das Testament auch einsehen. Dabei wird ein rechtliches Interesse immer dann angenommen, wenn die betreffende Person vom Inhalt des Testamentes Kenntnis haben muss, um ihre eigenen Rechte am Nachlass geltend machen zu können.

Die durch ein Testament Betroffenen, wie z. B. die Erben, die Enterbten, die Vermächtnisnehmer und die Nachlassverwalter werden in vielen Fällen offiziell zu einem Termin für die Testamentseröffnung geladen. Dabei besteht jedoch auch bei einer erfolgten Ladung zum Termin keine Anwesenheitspflicht der Beteiligten. Grundsätzlich wird der Prozess der Testamentseröffnung immer protokolliert und die Beteiligten erhalten davon eine Abschrift. Jedoch hat die Teilnahme an einem offiziellen Testamentseröffnung Termin für die Beteiligten den Vorteil, dass sie hierbei einen Einblick in das gesamte Testament des Erblassers erhalten. Hingegen wird in den Protokollen zum Testament, die postalisch zugestellt werden, oft enthalten, die für den jeweiligen Betroffenen relevant sind.
Der Rechtspfleger des Gerichts kann Kopien des Testaments an diejenigen Personen verschicken, die als Miterben des Nachlasses in Betracht kommen oder aber hierfür einen Eröffnungstermin bei Gericht ansetzen und die Beteiligten dazu laden. In einem Eröffnungstermin verliest er dann den Inhalt des Testamentes und stellt zusätzliche Informationen zur Verfügung, wie z. B. zur Anerkennung der Echtheit der Urkunde, evtl. Ausschlagungen der Erbschaft, eine anstehende Erbauseinandersetzung oder die Änderung von Grundbucheinträgen bei Immobilien und Grundstücken. Für den Fall, dass ein Erbe die Verfügungen des Erblassers nicht anerkennen will, kann er entsprechende Passagen im Testament gerichtlich überprüfen lassen.
Wenn ein Testament beim Nachlassgericht eröffnet wurde und die Beteiligten über die Testamentsinhalte informiert wurden, ist dies auch der Beginn für die Frist, in der die Erben ihre Erbschaft ausschlagen können. Dabei kann dann jeder Erbe innerhalb von sechs Wochen gegenüber dem Rechtspfleger erklären, die Erbschaft auszuschlagen. Ferner kann er auch bei einem Notar die Ausschlagung beurkunden lassen, der daraufhin das Gericht informiert. Auch einen möglichen Pflichtteilsanspruch muss man innerhalb von 3 Jahren gegenüber den Erben geltend machen, da er ansonsten verfällt.
Hierbei beginnt die Verjährungsfrist für die Pflichtteile mit dem Jahresende, in welchem der Pflichtteilsberechtigte das Schreiben über die Testamentseröffnung erhalten hat. Ähnliches gilt auch für den Anspruch auf die Herausgabe eines Vermächtnisses. Hierbei beträgt die Verjährungsfrist ebenfalls 3 Jahre, Ausnahme bilden hier jedoch Immobilien als Vermächtnisse, bei denen eine Verjährungsfrist von 10 Jahren gilt. Für den Fall, dass ein Testament seit mehr als 30 Jahren in amtlicher Verwahrung befindet, wird ein Nachlassgericht von Amts wegen ermitteln, ob der entsprechende Erblasser noch lebt. Wenn dies nicht festgestellt werden kann, muss das Gericht eine Testamentseröffnung von Todes wegen einleiten. Damit erfahren also evtl. Erben immer nach spätestens 30 Jahren von ihrer Einsetzung als Erbe.
Wenn eine Ehepaar ein gemeinschaftliches Testament errichtet hat, werden beim Eröffnen eines Testamentes nur die Verfügungen des verstorbenen Ehepartners bekannt gemacht. , wie sie sich von den Verfügungen des verstorbenen Partners nicht trennen lassen gemäß § 349 FamFG. Für den Fall, dass die Trennung der Verfügungen nicht möglich ist, wie z. B. bei einem Berliner Testament, dürfen gemeinschaftliche Testamente dann auch vollständig verkündet werden. Für den Fall, dass sich das gemeinschaftliche Testament in einer amtlichen Verwahrung befindet, wird von der Verfügung des verstorbenen Partners eine Kopie angefertigt und das Testament dann wieder in die amtliche Verwahrung gegeben. Gleichermaßen wird auch bei Erbverträgen vorgegangen.
Auch wenn eine Testamentseröffnung bei hinterlegten Testamenten automatisch abläuft, fallen für die Gerichtstätigkeit Gebühren in Höhe von 100 € an nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GnotKG). Ferner kommen hierzu noch Kosten für Auslagen, wie z. B. Porto, Versand, Papierkosten etc.. Für den Fall, dass eine Testamentseröffnung von einem Notar vorgenommen wird, werden hier nochmals 19 % Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt. Dabei bleiben jedoch diese Kosten auch bei einer Eröffnung mehrerer Testamente gleich. Diese Kosten müssen von den rechtmäßigen Erben im Anschluss an die Eröffnung entrichtet werden, jedoch können sie als Nachlassverbindlichkeit vom Nachlass abgezogen werden. Dadurch werden die Kosten auf alle Erben verteilt.
Erst nach einer erfolgten Testamentseröffnung beginnt ein Erbfall im Sinne des deutschen Erbrechts. Dabei sind in aller Regel sowohl die Erben als auch die Vermächtnisnehmer und die Pflichtteilsberechtigen bereits festgelegt. Für den Fall, dass diese keinen Gebrauch von einer Erbausschlagung innerhalb von 6 Wochen machen, stehen die endgültigen Erben ab diesem Zeitpunkt dann fest. Für den Fall, dass es mehrere Erben gibt, bilden diese gemeinsam zunächst eine Erbengemeinschaft.
In deren gemeinsamen Besitz dann der Nachlass zunächst vollständig über geht. Daraufhin werden zunächst evtl. Nachlassverbindlichkeiten des Erblassers aus dem Vermögen der Erbschaft getilgt. Der davon bereinigte Nachlass ist dann Gegenstand einer Erbauseinandersetzung unter den Erben, die eine Aufteilung des Erbes unter allen Erben meint entsprechend den Verfügungen des Erblassers in seinem Testament. Durch die vollständige Aufteilung des Erbes auf alle Miterben wird dann im Anschluss die Erbengemeinschaft aufgelöst.
Nach einer Testamentseröffnung erhalten die Erben nicht automatisch auch einen Erbschein. Dieser muss zuerst beim zuständigen Nachlassgericht beantragt werden. Allerdings ist nicht in allen Fällen ein Erbschein nötig und es können viele Maßnahmen bzgl. des Nachlasses bereits mit dem Testament erfolgen.
Testamentseröffnungen sind Angelegenheiten, bei denen die meisten Menschen nicht viel Erfahrung haben und sich zunächst einmal darüber informieren wollen, was sie dabei zu beachten und zu wissen haben. Hierfür ist ein erfahrener Anwalt für Erbrecht ein guter Partner, der alle Fragen rund um die Testamentseröffnung, den Ablauf und die entsprechenden Fristen genau beantworten kann.
Dabei steht ein Anwalt für Erbrecht seinem Mandanten natürlich auch in problematischen Fällen zur Seite, wenn sich z. B. aus der Testamentseröffnung ergibt, dass sein Mandant nicht angemessen berücksichtigt wurde in einem Testament. In Bezug auf die Einhaltung von Fristen nach der Testamentseröffnung kann ein Anwalt auch unterstützen, die richtigen Anforderungen für Ansprüche an die richtigen Stellen weiterzuleiten und der Anwalt kann auch die Kommunikation und Korrespondenz zwischen den Miterben übernehmen, wenn im Falle von Erbstreitigkeiten keine direkte Kommunikation mehr möglich ist. Lassen Sie sich beraten zu einer Testamentseröffnung von einem erfahrenen Anwalt für Erbrecht.

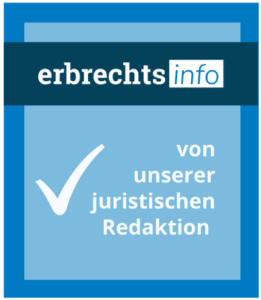
Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung