Das Ehegattentestament bezeichnet gemäß § 2265 BGB nach dem Ehegatten Erbrecht eine Verfügung von Todes wegen, die nur von Ehepartnern bzw. eingetragenen Lebenspartnern gemeinsam errichtet werden kann. Hierbei regeln entsprechende Paare ihren gemeinsamen Nachlass und die Aufteilung ihres Vermögens und ändern damit die gesetzliche Erbfolge ab.
Dabei kommt dem Ehegattentestament insbesondere die Aufgabe zu, den länger lebenden Partner im Erbfall abzusichern und dabei z. B. durch die Erbschaft Ehepartner sicherzustellen, dass dieser auch weiterhin in einer gemeinsamen Eigentumswohnung leben kann.
Für langjährige Lebensgefährten, die jedoch nicht in einer eingetragenen Partnerschaft leben besteht diese Möglichkeit hingegen nicht. Für den Fall, dass man sicherstellen will, dass der Lebensgefährte im Erbfall nicht durch die Anwendung der gesetzlichen Erbfolge leer ausgeht, kann man ihn in einem Testament oder einem Erbvertrag bedenken. Dabei kann durch die Testierfreiheit des Erblassers grundsätzlich frei entschieden werden, wer an seinem Nachlass beteiligt werden soll.
Für den Fall, dass keine letztwillige Verfügung vorhanden ist, kommt in Deutschland regelmäßig die gesetzliche Erbfolge zur Anwendung, die gerade bei Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften viele Nachteile mit sich bringt. Dabei entsprechen die wirtschaftlichen Folgen der gesetzlichen Erbfolge oft nicht dem Willen des Erblassers und eine besondere Fürsorge für bedürftige Familienmitglieder ist nicht möglich. Hierbei bilden der überlebende Ehepartner und die Kinder des Erblassers eine so genannte Erbengemeinschaft, bei der jedem Erben nur einen bestimmten Anteil am Nachlass beanspruchen kann.
Deshalb können in diesem Fall nur alle Erben gemeinsam über den Nachlass verfügen, da dem einzelnen Mitglied der Erbengemeinschaft nicht von vorneherein einzelne Gegenstände zustehen. Dabei müssen sich die Miterben über die Verwaltung und Nutzung des Nachlasses einigen. Hierbei hat dann evtl. auch ein Ehepartner, mit der Ausnahme des Voraus, nicht die alleinige Verfügungsgewalt über den Nachlass und ist dann unter Umständen unzureichend versorgt.
Ferner können die Kinder des Erblassers vom überlebenden Ehepartner jederzeit verlangen, dass der Nachlass geteilt wird. Für den Fall, dass der Ehepartner nicht über genügend Geldmittel verfügt, um die Kinder auszuzahlen, können diese eine Nachlassteilung verlangen. Dabei kann es dann auch z. B. zu einer Teilungsversteigerung eines Hauses kommen. Außerdem besteht auch bei einem Verzicht der Kinder auf ihre Erbteilauszahlung immer noch die Notwendigkeit, dass der Ehepartner sich mit den Kindern einigen muss. Zusätzlich entfällt auch die Möglichkeit, über eine durchdachte Verteilung des Nachlasses die Erbschaftssteuer zu minimieren.
Für den Fall, dass ein Unternehmen zum Nachlass gehört, kann dessen Existenz durch eine handlungsunfähige Erbengemeinschaft gefährdet werden. Dabei können dann auch oft wichtige unternehmerische Entscheidungen gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung getroffen werden. Deshalb kann hierdurch auch Versorgung des überlebenden Ehegatten gefährdet werden. Um all diese Nachteile vermeiden zu können, sollten immer durch ein überlegtes Testament bzw. ein Ehegattentestament Vorsorge getroffen werden.
Grundsätzlich gibt es nicht das eine Ehegattentestament. Juristen unterscheiden neben den unterschiedlichen Varianten (zum Beispiel das Berliner Testament) auch nach Art des Ehegattentestament. Hierfür gibt das Gesetz drei Möglichkeiten vor. Diese sind:
Das gleichzeitig gemeinschaftliche Testament
Dabei handelt es sich beim gleichzeitig gemeinschaftlichen Ehegattentestament um zwei einzelne letztwillige Verfügungen, die nur äußerlich miteinander verbunden werden. Hierbei bedeutet dies, dass diese Testamente und die darin getätigten Formulierungen inhaltlich nicht miteinander in Verbindung stehen und auch nicht in irgendeiner Weise aufeinander abgestimmt sind. Dabei wird diese Form des Ehegattentestamentes lediglich von beiden Partnern zum gleichen Zeitpunkt verfasst.
Für den Fall, dass jeder Partner ein eigenes Testament aufsetzt, wobei beide Testamente eine gegenseitige Begünstigung enthalten, sprechen Juristen von einem gegenseitigen Ehegattentestament. Dabei besteht zwischen den letztwilligen Verfügungen eine inhaltliche Verbindung. Jedoch existiert zwischen den beiden Testamenten keine Abhängigkeit, die sich auf die Wirksamkeit auswirken könnte. Hierbei ist dies besonders dann relevant, wenn eines der Testamente nachträglich als ungültig erklärt wird. In diesem Fall behält das andere Testament weiterhin seine Gültigkeit.
Allerdings entspricht das wechselbezügliche Ehegattentestament zumeist am ehesten dem, was man gemeinhin unter einem „gemeinschaftlichen Testament“ versteht. Dabei handelt es sich um ein Testament, in dem die Ehepartner bzw. Lebenspartner ihre gemeinsamen Formulierungen festhalten. Ferner ein wichtiges Merkmal dieser Testamentsform sind die voneinander abhängigen Verfügungen, wie etwa die gegenseitige Einsetzung als Alleinerbe. Hierbei bezieht sich die Abhängigkeit auch auf die Wirksamkeit des letzten Willens, denn sobald die Verfügung eines Partners aus einem Grund unwirksam wird, gilt dies automatisch auch für die Verfügung des anderen Partners.
Eine Sonderform des wechselbezüglichen Ehegattentestaments ist das sogenannte Berliner Testament. Hierbei geht es grundsätzlich darum, zunächst einmal den überlebenden Ehe – oder Lebenspartner abzusichern, bevor der Nachlass auf weitere gesetzliche Erben verteilt wird. Deshalb setzen Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner hierbei ein gemeinsames Testament auf, bei dem sie sich gegenseitig zu Alleinerben erklären.
Dabei ist dann bereits für zwei verschiedene Erbfälle die Aufteilung des Erbes gleichzeitig geregelt. Für den ersten Erbfall wird bestimmt, dass der gesamte Nachlass auf den überlebenden Partner übergeht, der dadurch ein Vorerbe wird, da alle anderen gesetzlichen Erben zu diesem Zeitpunkt noch vom Erbe ausgeschlossen werden. Diese erben dann erst im zweiten Erbfall, wenn auch der zweite Partner verstorben ist. Deshalb bezeichnet man sie auch als Nacherben.
Beim Berliner Testament sind die getroffenen Verfügungen auch nach dem ersten Erbfall für den überlebenden Partner bindend. Dabei kann dieser dann keine anderen Regelungen mehr für seinen Nachlass treffen und ist weiterhin an das gemeinsame Berliner Testament gebunden. Hierbei kann z. B. kann ein Kind vom überlebenden Elternteil nicht mehr nachträglich enterbt werden, wenn es bereits durch das Testament zum Nacherben bestimmt wurde. Jedoch ist es möglich, auch im Berliner Testament eine Freistellungsklausel einzufügen, die es dem länger lebenden Partner ermöglicht, trotz des Ehegattentestaments abweichende, neue Regelungen zu treffen.
Ein gemeinsames Testament können nach dem deutschen Erbrecht Ehegatten nur Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner miteinander aufsetzen. Hierbei gilt dies nach dem Erbrecht Lebensgefährte auch bei einer z. B. fast lebenslangen Partnerschaft, die durchaus wie eine Ehe geführt wird. Für den Fall, dass man den eigenen Lebensgefährten im eigenen Erbfall begünstigen möchte, ist dies nur durch ein eigenes Testament oder ggf. einen Erbvertrag möglich. Dabei erlaubt die Testierfreiheit es einem Erblasser , frei über die Verteilung seines Vermögens im Erbfall zu entscheiden und deshalb kann er eben auch einen nicht eingetragenen Lebenspartner als Erbe einsetzen. Zu beachten sind allerdings evtl. Pflichtteilsansprüche erbberechtigter Angehöriger.
Jedoch kann man die wirtschaftliche Versorgung eines Ehepartners oder auch nicht eingetragenen Lebensgefährten auch durch eine Lebensversicherung gewährleisten. Hierbei handelt es sich dann um eine Vermögensübertragung unter Lebenden auf den Todesfall, die zur Folge hat. Dabei wird dann die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Erbfalls an den Partner übertragen und fällt dabei auch nicht in den Nachlass. Allerdings unterliegt eine fällige Lebensversicherung, die an den Berechtigten ausgezahlt wird, der Erbschaftsteuer. Hingegen fällt keine Erbschaftsteuer an, wenn der Versicherungsnehmer gleichzeitig die bezugsberechtigte Person und der Beitragszahler ist, ein Dritter aber die versicherte Person.
Für den Fall, dass Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner ein gemeinsames Testament aufsetzen wollen, sind hierbei eine Reihe von Vorschriften zu beachten.
Generell gibt es keine speziellen Vorschriften zur Form, in der eine Ehegattentestament zu erstellen ist. Jedoch muss bei einem Berliner Testament zumindest dieses in einem einzigen Dokument erstellt werden, von einem Erblasser vollständig handschriftlich niedergeschrieben werden und von beiden Ehepartnern dann unterschrieben werden. Bei allen anderen Formen des Ehegattentestamentes werden meist zwei Testamente verfasst, die sowohl handschriftlich als auch bei einem Notar erstellt werden können.
Jedoch ist es auch bei getrennten Ehegatten Testamenten immer sinnvoll, diese gemeinsam und miteinander verbunden aufzubewahren (zusammengeheftet), um im Erbfalle aufzuzeigen dass es sich um gemeinsame Verfügungen handelt. Ein Ehegattentestament muss dabei nicht zwingend von einem Notar beurkundet werden, da keine Notarpflicht besteht. Jedoch kann die notarielle Beurkundung gewährleisten, dass im Erbfall die Echtheit des Testaments nicht in Frage gestellt wird.
Inhaltlich unterscheidet sich ein gemeinsames Testament zumeist nicht von einem Einzeltestament. Dabei kann jeder Ehepartner Verfügungen treffen, die er auch für sich in einem Einzeltestament getroffen hätte. Dabei handelt es sich grundsätzlich um folgende Anordnungen:
Dabei ermöglicht es die Freistellungsklausel dem länger lebenden Partner, die gemeinsamen Verfügungen nach dem ersten Erbfall nochmals zu ändern. Für den Fall, dass diese Vereinbarung fehlt, ist der überlebende Partner nach dem ersten Erbfall an diese Verfügungen gebunden und kann keine Änderungen mehr vornehmen. Ferner wird durch eine Wiederverheiratungsklausel verhindert, dass der Nachlass des verstorbenen ersten Partners in die neue Familie des länger lebenden Partners einfließt, da ansonsten der neue Ehepartner durch die neue Ehe auch erbberechtigt wäre. Deshalb wird mit dieser Klausel meist geregelt, dass der Nachlass des verstorbenen Ehepartners bei einer erneuten Heirat ganz oder teilweise an die bereits bestimmten Nacherben herausgegeben werden muss.
Allem voran, wenn Kinder aus vorherigen Beziehungen einen Anspruch auf den gesetzlichen Pflichtteil haben, kommt es im Erbfall oftmals zu Erbstreitigkeiten im Zusammenhang mit einem Ehegattentestament. Denn ist der länger lebende Partner Stiefvater oder Stiefmutter, führt eine Alleinerbe Regelung im gemeinsamen Testament schnell zu Missgunst, hitzigen Wortgefechten und nicht selten ausufernden womöglich gar Erbstreitigkeiten. Derartige Probleme lasen sich jedoch, mithife einer anwaltlichen Beratung im Zuge der Testamentserstellung vermeiden!
Generell haben die gesetzlichen Erben immer einen Pflichtteilsanspruch, auch bei gemeinschaftlichen Testamenten. Dabei meint diese eine durch das Gesetz garantierte Mindestbeteiligung am Erbe für Angehörige des Erblassers. Für den Fall, dass sich Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner gegenseitig als Alleinerben einsetzen, können die übrigen Erben trotzdem ihren Pflichtteil vom überlebenden Partner einfordern. Hierbei sind oft Konflikte vorprogrammiert und diese gesetzliche Regelung birgt ferner in vielen Fällen ein finanzielles Risiko für den überlebenden Partner.

Um dieses Problem zu lösen, sieht das Erbrecht die Möglichkeiten eines Pflichtteilsverzichts, einer Reduzierung des Pflichtteils sowie auch Pflichtteilsstrafklauseln vor. Hierbei können Ehepartner bereits vor einer Erstellung des gemeinsamen Testamentes mit den übrigen Erben einen Pflichtteilsverzicht vereinbaren.
Dabei wird dann mit den entsprechenden Erben ein Pflichtteilsverzichtsvertrag abgeschlossen, in dem der entsprechende Erbe auf seinen Pflichtteil verzichtet und ihn damit nicht mehr vom überlebenden Partner einfordern kann. Ferner können auch über verschiedene Maßnahmen Pflichtteile reduziert oder vollständig aufgehoben werden. Hierbei bieten z. B. Schenkungen zu Lebzeiten an gesetzliche Erben eine Möglichkeit, den Wert des Nachlasses zu senken im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge. Allerdings sind hierbei evtl. Pflichtteilsergänzungsansprüche zu beachten.
Außerdem kann auch in einem Ehegattentestament eine sogenannte Pflichtteilsstrafklausel eingefügt werden. Dabei können Pflichtteilsansprüche gegenüber dem überlebenden Partner vermieden werden, wenn die Erben nicht freiwillig verzichten. Durch die Pflichtteilsstrafklausel wird bestimmt, dass Pflichtteilsberechtigte und deren Nachkommen von der Erbfolge nach dem zweiten Erbfall ausgeschlossen werden können, wenn sie Pflichtteilsansprüche gegen den Willen des überlebenden Partners im ersten Erbfall durchsetzen.
Für den Fall, dass Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner ein gemeinsames Testament erstellt haben, kann dies durch bestimmte Veränderungen in der Lebensbiographie der Partner beeinflusst werden. Hierbei spielen sowohl eine Scheidung als auch eine Wiederheirat sowie ein gleichzeitiges Versterben der Partner durch z.B. einen Unfall eine Rolle.
Wenn eine Ehepaar ein gemeinsames Testament erstellt hat und sich scheiden lässt, so verliert dieses Ehegattentestament seine Gültigkeit. Hierbei muss jedoch das Testament aktiv außer Kraft gesetzt werden. Deshalb reicht bei einem privatschriftlich verfassten Testament dessen Vernichtung aus um es ungültig zu machen. Hingegen muss ein notariell erstelltes und verwahrtes Testament zunächst vom Notar zurückgefordert und dann vernichtet werden. Hierdurch lässt sich vermeiden, dass bei einer Scheidung ein geschiedener Partner noch Ansprüche aus diesem Testament geltend machen kann, sofern nicht festgelegt wurde, dass dieses Testament auch nach einer Scheidung weiterhin Gültigkeit behalten soll.
Für den Fall, dass ein überlebender Partner erneut heiratet, wird ein neuer Ehepartner automatisch erbberechtigt und auch pflichtteilsberechtigt. Für den Fall, dass Kinder aus der ersten Ehe im Ehegattentestament als Nacherben eingesetzt wurden, besteht das Risiko, dass sie durch die neue Ehe eines Elternteils weniger vom Nachlass der Eltern erhalten.
Deshalb kann man durch eine Wiederverheiratungsklausel diesen Umstand vermeiden. Dabei geht das bereits angefallene Erbe bei einer erneuten Heirat auf die Nacherben über und der Nachlass des verstorbenen Elternteils wird dadurch endgültig geregelt. Fehlt diese Klausel, muss der überlebende Partner innerhalb eines Jahres nach einer erneuten Heirat das Testament anfechten, wenn er z. B. den neuen Partner im Erbfall berücksichtigen will. Jedoch ist eine derartige Anfechtung nur dann erfolgreich, wenn ein gesetzlich definierter Anfechtungsgrund vorliegt.
Durch eine Ehegattentestament können die Partner auch für den Fall, dass sie gleichzeitig versterben, vorsorgen. Hierbei wird durch den Einsatz einer sogenannten Katastrophenklausel die Erbaufteilung bestimmt. Dabei kann hiermit z. B. bestimmt werden, dass in einem solchen Falle der Nachlass direkt auf die Nacherben übergeht. Jedoch sollte über eine Katastrophenklausel auch ein zeitnahes Versterben beider Partner berücksichtigt werden. Hierbei kann z. B. verfügt werden, dass diese Regelung auch gültig sein soll, für den Fall, dass die Partner in einem Abstand von 2 Monaten nacheinander versterben.
Für ein Ehegattentestament fallen nur dann Kosten an, wenn es entweder bei einem Notar erstellt und beglaubigt wird oder wenn man die Hilfe eines Anwalts für Erbrecht dabei in Anspruch nimmt.
Dabei sind die Gebühren für die notarielle Leistung nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) geregelt, das eine einfache Gebühr (1,0) für Ehegattentestamente, die aus zwei einzelnen Testamenten bestehen vorsieht. Hingegen wird für ein Berliner Testament die doppelte Gebühr (2,0) veranschlagt. Hierbei ist die Höhe der Gebühr immer auch abhängig vom Wert des Nachlasses und damit vom gesamten Vermögen, das über das Testament geregelt wird. Beispielhaft können in untenstehender Tabelle die ungefähren Gebühren für die verschiedenen Nachlasswerte entnommen werden:
| Nachlasswert | Einzeltestament | Berliner Testament |
|---|---|---|
| 10.000 Euro | 75 Euro | 156 Euro |
| 50.000 Euro | 165 Euro | 330 Euro |
| 100.000 Euro | 273 Euro | 546 Euro |
| 200.000 Euro | 435 Euro | 870 Euro |
| 500.000 Euro | 935 Euro | 1.870 Euro |
Für den Fall, dass man die Hilfe eines Anwalts bei der Erstellung des Testamentes in Anspruch nimmt, werden hierfür natürlich auch Honorare fällig. Jedoch sind diese nicht einheitlich geregelt und können individuell sowohl als Stundensätze sowie ggf. auch durch eine Pauschalvergütung vereinbart werden.
Tritt ein Erbfall ein, findet die Eröffnung eines gemeinschaftlichen Testaments immer an einem festgelegten Eröffnungstermin statt, der vom zuständigen Nachlassgericht bekannt gegeben wird. Hierbei wird dann den Anwesenden Erben der Inhalt mitgeteilt und abwesende, erbberechtigte Personen werden per Post über die Verfügungen informiert. Allerdings gelten dabei nach § 2273 BGB jeweils unterschiedliche Regeln für die Eröffnung des Testaments beim ersten und beim zweiten Erbfall .
Hierbei werden nach dem ersten Erbfall bei einer Testamentseröffnung nur die Verfügungen des verstorbenen Partners und die davon abhängigen Verfügungen des überlebenden Partners verkündet. Deshalb wird im ersten Erbfall also nicht das gesamte Testament eröffnet. Nach dem zweiten Erbfall wird hingegen das gesamte Ehegattentestament erneut eröffnet. Dabei werden dann die Verfügungen des zuletzt verstorbenen Partners bekannt gegeben und den folgenden Erben ist erst nach diesem Termin das gesamte Ehegattentestament bekannt.
Es ist generell immer möglich, ein Testament zu ändern oder auch zu widerrufen. Allerdings ist bei einem Ehegattentestament dabei entscheidend, in welcher Form es erstellt wurde. Für den Fall, dass es sich um zwei getrennte Testamente wie das gleichzeitig gemeinschaftliche und gegenseitige Testament handelt, gelten für eine Änderung und einen Widerruf dieselben Regeln wie bei jedem Einzeltestament. Dabei wird in der Regel bei einer Änderung das bestehende Testament durch ein neues Testament mit neuen Inhalten ersetzt und es bestehen zwei Testamente, die sich inhaltlich ergänzen.
Hingegen muss für einen Widerruf nur das Dokument vernichtet werden und es kann dann auch ein neues Testament aufgesetzt werden. Für den Fall, dass die Testamente durch einen Notar erstellt wurden, muss man diesen sowohl bei einer Änderung als auch bei einem Widerruf kontaktieren, das hierbei das Testament amtlich verwahrt wird und trotz einer privatschriftlichen Änderung oder auch Vernichtung weiterhin Gültigkeit besitzen würde. Hingegen ist bei einem Berliner Testament eine Änderung oder auch ein Widerruf nur bei Vorliegen bestimmter Bedingungen möglich und auch nur zu den Lebzeiten beider Partner. Hierbei kann nach dem ersten Erbfall nicht mehr geändert oder widerrufen werden, es sei denn, es wurde eine entsprechende Freistellungsklausel vereinbart.
Allerdings können zu Lebzeiten beider Ehepartner sowohl eine Änderung als auch Widerruf gemeinsam oder auch einzeln vorgenommen werden. Für den Fall, dass sie sich zu einem gemeinsamen Widerruf entscheiden, können sie ein Widerrufstestament erstellen, einen Erbvertrag abschließen, der dem Testament widerspricht oder auch das Dokument einfach vernichten. Wenn allerdings ein Partner alleine einen Widerruf oder eine Änderung erwirken will, muss er eine persönliche Erklärung notariell beurkunden lassen und an den anderen Partner zustellen lassen, um wirksam zu sein.
Falls nach Eintritt eines Erbfalls Probleme mit dem Ehegattentestament sichtbar werden, kann eine Anfechtung möglich sein. Jedoch wird auch hierbei zwischen zwei Einzeltestamenten und z. B. einem Berliner Testament unterschieden. Hierbei können bei gemeinschaftlichen Testament, die aus zwei Einzeltestamenten bestehen, einzelne Anordnungen aus dem Testament angefochten werden. Dabei sind dann, im Falle einer erfolgreichen Anfechtung, nur diese Verfügungen ungültig und alle weiteren bleiben auch weiterhin gültig.
Hingegen sind bei wechselbezüglichen Testamenten (Berliner Testament) durch eine Anfechtung die Verfügungen beider Partner gleichzeitig angefochten, da diese voneinander abhängig sind. Für den Fall, dass eine Anfechtung erfolgreich ist, sind somit beide Verfügungen ungültig. Grundsätzlich kann ein Ehegattentestament nur von bestimmten Personen angefochten werden. Dabei handelt es sich um diejenigen Personen, die von der Anfechtung profitieren würden und meist die gesetzlichen Erben sind. Ferner ist auch nach einer Wiederheirat der neue Ehepartner erbberechtigt und kann deshalb auch ein Ehegattentestament anfechten.
Die Testamentserstellung ist auch bei einem gemeinschaftlichen Testament ein wichtiger Vorgang, der sehr gut überlegt sein sollte und eine professionelle Anfertigung braucht. Deshalb sollte man sich immer, wenn man ein Ehegattentestament erstellen will, vorab von einem erfahrenen Anwalt für Erbrecht beraten lassen. Hierbei kann dieser die Bedürfnisse eines Paares analysieren und über die verschiedenen Regelungsmöglichkeiten beraten.
Ferner hilft er natürlich auch bei einer rechtssicheren Formulierung der Verfügungen und klärt über die Konsequenzen auf. Außerdem kann ein natürlich auch helfen, wenn z. B. eine Anfechtung eines Testamentes notwendig sein sollte und seinen Mandanten dabei beraten und begleiten, sowie auch bei Gericht vertreten. Lassen Sie sich beraten zum Thema Ehegattentestament von einen erfahrenen Spezialisten für Erbrecht, um ihre Wünsche zur Vermögensverteilung rechtssicher in einem entsprechenden Testament zu regeln.

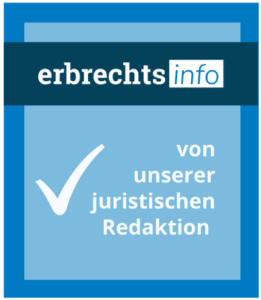
Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung